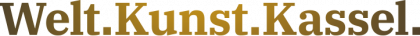Aktionsraum ERDEN:LEBEN
Natur, Kunst und Philosophie —
ein interdisziplinäres Projekt für die Zukunft der Erde
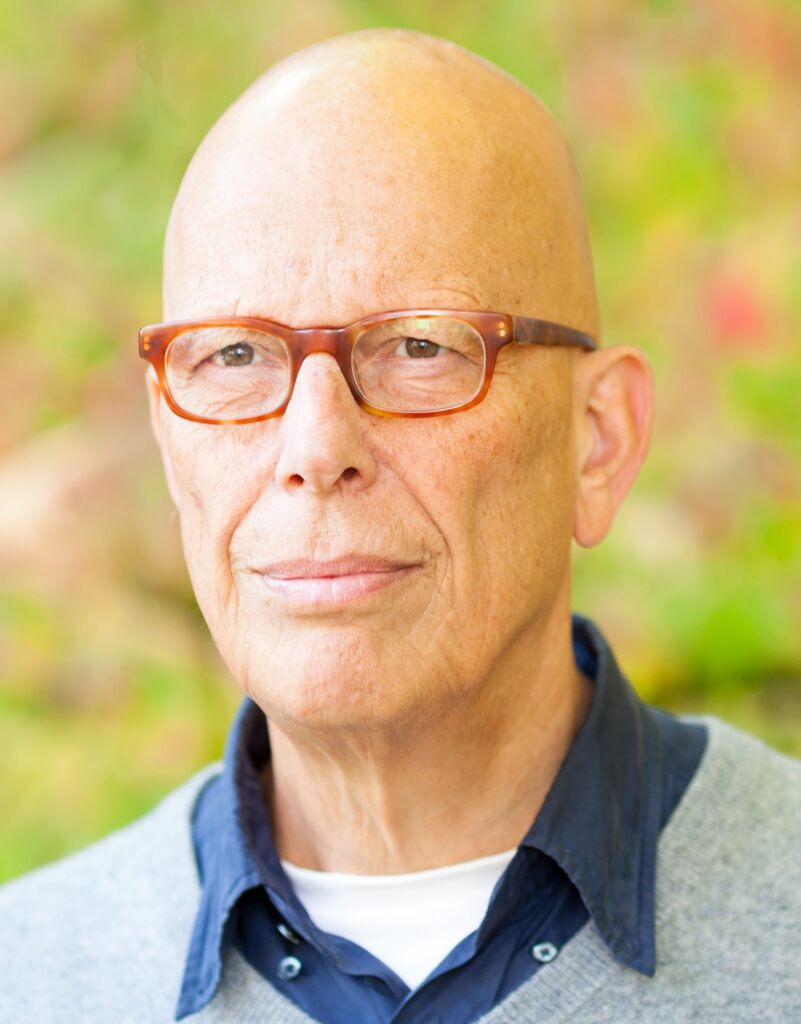
Michael Evers
In seinem interdisziplinären Projekt Aktionsraum ERDEN:LEBEN möchte der Künstler und Philosoph Michael Evers ein ökologisches Umdenken fördern.
Das Projekt ERDEN:LEBEN hinterfragt unser Konzept von Natur und schlägt eine kulturelle Wende vor, in der die Kunst eine Ressource darstellt, durch die
der Mensch wieder zur Natur finden kann.
Aktionsraum ERDEN:LEBEN ist ein interdisziplinäres Projekt zur Transformation des Verhältnisses von Mensch und Natur. Der Fortbestand der menschlichen Zivilisation ist in Frage gestellt angesichts der globalen Naturkrise. Die Symptome deuten auf das „Ende der Natur“, wie wir sie kennen; nicht nur unsere Lebensgrundlage, sondern auch die Schönheit gehen verloren. Unser Verhältnis zur Erde muss sich ändern, die rationalistisch-technologische Unterwerfung der Natur und die Zerstörung der Biosphäre müssen abgelöst werden durch eine neue, integrative Kultur, in der die Wertschätzung und die Sensibilität für Natur von zentraler Bedeutung sind.
Wir brauchen eine “neue Aufklärung” (Ernst Ulrich von Weizsäcker, Club of Rome, 2019). Wissenschaftler des Weltbiodiversitätsrats (2019) empfehlen „umfassende Maßnahmen auf allen gesellschaftlichen Ebenen“. Bislang will man die Natur mit ökonomischen Steuerungsmechanismen und mit technologischen Innovationen retten. Doch der ökologische Wandel fordert auch einen tiefgehenden Kulturwandel.
Aktionsraum ERDEN:LEBEN antwortet auf die Erfordernisse der Gegenwart mit Kunst und Philosophie. In den Handlungsräumen dieses Projekts steht die ästhetische und philosophische Welterfahrung im Zentrum und ist Ausgangspunkt für alles andere. Die aktuelle Debatte zur Umweltproblematik wird durch philosophische und künstlerische Interventionen erweitert; es können sich Freiräume öffnen, um eine Transformation des Verhältnisses von Mensch und Natur zu ermöglichen.
Aktionsraum ERDEN:LEBEN wendet sich an Menschen, die sich ganzheitlich orientieren und sich für eine kulturelle Wende einsetzen wollen. Er ist eine Plattform für Kooperationen und Partnerschaften aus Kultur, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.
In 3 Handlungsräumen soll der Beitrag für die Zukunft der Erde realisiert werden:
- Aktionen mit Künstlerinnen und Künstlern:
Poetische Interventionen – Natur-Kunst; ästhetische, transformatorische Prozesse - Denkwerkstatt Natur:
Im Rahmen eines philosophischen Gesprächsforums sollen aktuelle Stimmen, die das Naturproblem reflektieren, zu Wort kommen. Vorträge, Symposien und Seminare zu einer “neuen Aufklärung” und zu einer Philosophie der Natur - Naturästhetik-Workshops
Erfahrungsraum Natur, Wahrnehmungsübungen mit Farbe und Zeichenstift, ästhetische Praxis; Naturmeditation und Entschleunigung
Kontakt:
Michael Evers — Tel.: 0151 25630542 — fsog.michael.evers@web.de
Links:
Projekt Naturkunde: https://sites.google.com/view/natur-kunst
Raum für Künstlerische Kreativität: www.evers-kunst.de
Internetseite Michael Evers: www.michael-evers.net
fiveP: www.fivep.org
Aktionsraum ERDEN:LEBEN Kunst und Philosophie
Eine Kampagne für die Natur
Naturkrise und Bewusstseinswandel – philosophisches Gespräch mit Mathias Behrens und Michael Evers
Gespräch mit der Firma MELAWEAR über die ökologische Revolution und den Erweiterten Kunstbegriff
Das indigene Volk der Kogi als Inspiration für einen kulturellen Wandel und die Bedeutung der Kunst
Aktionsraum ERDEN:LEBEN
„Die Natur atmet in allem“
Podiumsdiskussion und Gespräch am 17. Mai 2023 im Naturkundemuseum
mit hochinteressanten Referenten

Perspektiven des kulturellen Wandels in der Naturkrise –
Wissenschaft, Philosophie und Kunst im Dialog
Referenten:
- Kai Füldner, Leiter des Naturkundemuseums Ottoneum, der „sozusagen die pragmatische, klassische Wissenschaft vertrat“ und als Museumsleiter nachhaltig unser Wissen über die Natur für künftige Generationen bewahren möchte.
- Paul Reszke, Sprachwissenschaftler (Projektgruppe Climate Thinking, Uni Kassel), der sich mit der Sprache und Kommunikation zum Thema Umwelt beschäftigt und Beuys als Beispiel nachhaltigen kommunikativen Handelns zwischen Kunst, Politik und Öffentlichkeit sieht: „Kunst ist die einzige Form in der Umweltprobleme gelöst werden können“, „Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung“.
- Martin Böhnert, Philosoph (Projektgruppe Climate Thinking, Uni Kassel), der den Klimawandel nicht nur wissenschaftlich, sondern auch kulturell und als Philosoph die Komplexität der Debatte untersucht und der bestätigte, dass wir uns, durch die Wissenschaft, von der Natur distanziert haben (dis-engagement).
- Michael Evers, Bildender Künstler und Philosoph, der bekräftigte, dass Kunst eine Brücke sein kann, um wieder die verlorene Verbundenheit zur Natur zu finden und die Erfahrung von Ästhetik uns der Natur wieder nah bringen kann. Das Problem sei die Distanz, die wir zur Natur erreicht haben, in der geschichtliche Trennung zwischen Logik und rationalem Denken und der Unterordnung der Sinnlichkeit und der Empfindungsfähigkeit. Kunst als ästhetische Naturerfahrung kann neues Empfinden ermöglichen.
- Moderation: Susanne Jakubczyk, Kunsthistorikerin
Die Podiumsdiskussion wollte, dank einer Erweiterung des Blickwinkels auf die Natur, einen Beitrag zur „ökologischen Transformation“ leisten.
Die Art und Weise, wie wir die Natur in unserer heutigen Gesellschaft verstehen, wird stark von den Naturwissenschaften beeinflusst. Dies zeigt sich in der Sprache, die im politischen Diskurs, in ökologischen Studien und in der Umweltbewegung verwendet wird, wo Daten und Fakten zur Formulierung von Positionen und zur Gestaltung von Perspektiven herangezogen werden.
Bei der Diskussion des Themas Umwelt ist es aber hilfreich, nicht nur aus der Perspektive der Wissenschaft zu betrachten, sondern auch die philosophischen und ästhetischen Perspektiven als neue Zugänge zu untersuchen.
Obwohl wir von Natur aus ein Teil der Natur sind, hat unsere moderne Lebensweise dazu geführt, dass wir uns von ihr distanziert und entfremdet haben.
Der immer größer werdende Abstand, die Autonomie und die Emanzipation von der Natur wurden als Zivilisation verstanden, aber wir sind von der Natur abhängig und wir können ohne sie nicht überleben. Es soll eine neue Wahrnehmung der Natur stattfinden in der die Natur nicht nur als Objekt, sondern als Subjekt wahrgenommen wird. Wir brauchen ein neues Verständnis des Menschen, das unsere Verantwortung für die Natur miteinschließt, eine neue naturverbundene Ethik jenseits der Naturbeherrschung, einen neuen Humanismus, eine neue Aufklärung, die mit dieser verengenden Sicht auf den Menschen aufräumt und Verantwortung für andere Lebewesen, für die Natur und für kommende Generationen erfasst. Kunst kann dabei zum Schlüsselelement werden.