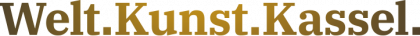Kultur
trifft
Leerstand
2
Ist das die Renaissance der Kasseler Innenstadt?
Kunst als Schlüssel zur urbanen Wiederbelebung.
Inmitten der Stadt herrscht ein enormer Leerstand, da viele Geschäfte häufig infolge der Pandemie ohne neue Mieter schließen mussten. Die zunehmende Verödung von Fußgängerzonen und Innenstädten bereitet Experten nicht erst seit Corona große Sorgen, unabhängig von der geografischen Lage.

Einkaufszentren, kleinere Dörfer oder auch größere Stadtzentren sind gleichermaßen betroffen. Hauptursache für den Leerstand ist das sich verändernde Einkaufsverhalten: Online-Käufe sind seit langem beliebt und wurden durch die Corona-Pandemie weiter verstärkt. Kleidung, Schuhe, Accessoires und Geschenke sind bequem von zu Hause aus zu bestellen. Die Energiekrise und Inflation verschlimmern die Situation noch zusätzlich.
Wege aus dieser Abwärtsspirale zu aufzuzeigen, ist eine der zentralen Ideen des Projekts „Kultur trifft Leerstand“. Im Fokus der Bemühungen sollen der Initiative nach in erster Linie die Innenstadtentwicklung und eine Belebung und Steigerung der Attraktivität der Innenstädte stehen.
Im Rahmen der „Kulturkonzeption Kassel 2030“ wurde 2022 das Festival „Kultur trifft Leerstand“ als Kulturprojekt ins Leben gerufen, um der Frage nachzugehen, wie Kultur zu einer zukunftsfähigen Nutzung der Kasseler Innenstadt beitragen kann. Finanziert wird das Projekt aus Mitteln des Hessischen Landesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte“, des Kulturdezernats und der Wirtschaftsförderung Region Kassel. Und das Projekt wurde auch bereits für 2024 mit einer Unterstützung des Bundes gesichert.
Das inspirierende Zusammenspiel von Wirtschaft und Kultur bringt Kunst und Kultur in leerstehende Geschäftsräume der Innenstadt und erprobt damit neue Nutzungskonzepte. „Kultur trifft Leerstand“ ermöglicht künstlerische Interventionen in leerstehenden Ladenlokalen im Kasseler Innenstadtbereich und eröffnet so neue Perspektiven auf diese zentralen Orte.
Kulturdezernentin Susanne Völker betonte die Bedeutung des Projekts als „wichtigen Beitrag für eine lebendige und zukunftsfähige Innenstadt“. Die eigens für die Ausstellung entwickelte Kunst zeigt kulturelle Nutzungsmöglichkeiten auf und macht die Räume auch für ein neues Publikum attraktiv.
Das Projekt eröffnet neue Sichtweisen auf leerstehende Gewerbeflächen in der Kasseler Innenstadt und hat bereits viele Künstler und Kulturschaffende angezogen, die ihre Werke und Ideen in den Räumen zeigen und die leerstehenden Räume nutzen möchten um ihre Kunst einem neuen Publikum zu präsentieren und damit auf gesellschaftliche Probleme aufmerksam zu machen.
Schon ab dem 13. Juli 2023 wurden die ungenutzten Räumlichkeiten in der Kölnischen Straße 19 einer neuen Bestimmung zugeführt und für eine Vielzahl von Studenten-Workshops genutzt. Einer dieser Workshops, geleitet von Nina Behboud, beschäftigte sich mit dem Thema “Körper in der Stadt” und setzte dabei auf die Technik der Collagekunst. Die Teilnehmer hatten die Gelegenheit, die Stadt aus einer ganz neuen Perspektive zu erleben. Die Keramikerin Christine Seefried nutzte ihre Expertise, um mit den Teilnehmern das Thema “Die Stadt als Materialerfahrung” zu erkunden, während die Künstlerin Liska Schwermer-Funke den Workshop zum Thema “Naturerleben in der Stadt — STADT_NATUR_WIR” betreute.
Die zweite Ausgabe von „Kultur trifft Leerstand“, kuratiert von Sarah Metz, startete nun offiziell am Donnerstag den 20. Juli um 18 Uhr mit einer Ausstellungseröffnung und anschließendem Rundgang durch die drei bespielten Leerstände, die in den kommenden 10 Tagen bespielt werden.
Die Eröffnung der wirklich beeindruckenden und absolut sehenswerten Initiative war ein voller Erfolg und übertraf aller Erwartungen. Viele Menschen kamen, um Kunst anzusehen und mit den Künstler*Innen darüber zu sprechen. Es war überraschend, wie positiv die Reaktionen waren.
Elkin Kutluer
Theaterstraße 3
Die Kulturdezernentin Susanne Völker eröffnete die Aktion „Kultur trifft Leerstand“ um 18 Uhr in der Theaterstraße 3, wo die Künstlerin Elkin Kutluer, die in der Klasse Slotawa der Kunsthochschule Kassel studiert, Ihre Fundstücke Arbeiten „Sand im Getriebe“, in der sie das Zusammenspiel von Zeit, Bewegung und den dadurch entstehenden Zerfall zeigt, präsentierte. 7 Plattenspieler spielen 7 Tage lang und jeden Tag wird es einer weniger, zerstört durch den auf Plattenspieler und Schallplatte rieselnden Sand. Die Künstlerin möchte auf die globalen Umweltkrisen durch den übermäßigen Abbau von Sand aufmerksam machen.
© Fotos: Kai Frommann
Katja Lonzeck und Charlotte Stamm
Königsstraße 44
Danach ging um 19 Uhr mit kunstinteressierten Gästen des Rundgangs in die Untere Königsstraße 44 weiter, wo die Künstlerinnen Katja Lonzeck und Charlotte Stamm mit der Performance „Kshhhhh“ über den Spiegel der Gesellschaft aus der Perspektive einer Stadttaube, beeindruckten. Stadttauben werden von den Menschen entweder geliebt oder gehasst. Durch ihre ständige Anwesenheit ist die Stadttaube nun „Expertin der Stadt und ihrer menschlichen Bewohner*innen geworden“ und spiegelt deren Verhalten.
Paula Mierzowsky und Janosch Feiertag
Kurt‐Schumacher Straße 31
Paula Mierzowsky und Janosch Feiertag stellen ihre Rauminstallation„Waldmeister Tempel Sale“ in der Kurt‐Schumacher Straße 31 in einer surrealen, einzigartigen Atmosphäre aus und befassen sich mit einer ironischen Note des Ausverkaufs mit Kultstätten des Konsums, Werteverfall und dem Bedürfnis nach Halt und Zuspruch durch Natur und Spiritualität. Frösche dienen hier als Symbole für die Natur und das Leben und erinnern uns daran, wie wichtig es ist, die Umwelt zu schützen und zu repsektieren.
Viele Besucherinnen und Besucher sagten, dass sie durch die Ausstellung einen neuen Blick auf die leerstehenden Räume bekommen hätten. Statt sie als triste Lücken in der Innenstadt zu sehen, sahen sie nun die Möglichkeit, sie als kreative Orte zu nutzen. Und die beteiligten Künstler*Innen waren natürlich glücklich, dass sie durch das Projekt „Kultur trifft Leerstand“ nicht nur ihre Kunst zeigen konnten, sondern auch dazu beitragen, die Sichtweise auf die Innenstadt zu verändern. Wenn viele Menschen sich engagierten, könnten auch scheinbar ungenutzte Flächen zu Orten der Begegnung und Inspiration werden.
Die Initiative zeigt auch: Städte und kreative Szenen – das gehört zusammen. Und: Städte verändern sich. Sie sind lebendige Systeme.
In Zeiten, in denen die Welt immer mehr aus den Fugen zu geraten scheint und in denen die Gesellschaft immer stärker an den Strukturen unseres Daseins zerrt, werden Kunst und Kultur immer bedeutsamer. Wenn die Welt unübersichtlicher wird, brauchen wir erst recht Orte, die Orientierung geben und Begegnung ermöglichen.
Und wenn kreative Köpfe und Künstler sich in einem Stadtviertel niederlassen, weil es dort noch erschwinglichen Wohn- oder Atelierraum gibt, hat dies Auswirkungen auf die Umgebung. Neue Angebote entstehen in Form von kleinen Galerien, Design-Läden und Clubs, die der kreativen Szene folgen.
Es ist deswegen ratsam, insbesondere in städtischen Gebieten, Kunst, Kultur und die Kreativwirtschaft in die Überlegungen zur Stadtentwicklung miteinzubeziehen. Denn das Wesen der Urbanität besteht darin, verschiedene Nutzungsarten wie Gewerbe, Wohnen, Arbeit und Freizeit zu mischen. Soziale und kulturelle Einrichtungen tragen maßgeblich zum Wohlbefinden der Bewohner und einer funktionierenden Nachbarschaft bei. Es ist daher im wohlverstandenen Eigeninteresse von Projektentwicklern und Investoren, diese Aspekte zu berücksichtigen.
Wenn sich Politik oder Stadtplanung deswegen entschließen, Kultur explizit in ihre Planungen einzubeziehen, geschieht dies oft mit dem Ziel, ein Viertel aufzuwerten, Veränderungsprozesse zu begleiten, Akzeptanz zu erreichen, die Nachbarschaft zu stärken oder die Integration voranzutreiben. All diese Ziele sind ehrenwert und positiv, allerdings sind sie auch mit einer besonderen Verantwortung verbunden: die Verantwortung für einen Transformationsprozess, der häufig Sorgen und Ängste auslöst. Wandel ist seit jeher ein ambivalentes Thema zwischen Hoffnung und Unsicherheiten.
[ Von Sonja Rosettini ]
Die Öffnungszeiten der der Ausstellungen sind am 21. und 22. Juli 2023 sowie vom 26. bis 29. Juli 2023 von jeweils 15 bis 19 Uhr.
Die Performance in der Unteren Königsstraße 44 findet jeweils von 17 bis 19 Uhr statt.
Eintritt frei.