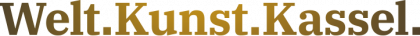BEUYS UND DIE DOCUMENTA
Zwischen Vitrine und Regal
Von Harald Kimpel

„Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kinder!“
So begann Joseph Beuys 1977 seine satellitenübertragene Ansprache zur Eröffnung der 6., der Medien-documenta in Kassel. Und er sprach mit dieser Formel nicht nur uns (abwesende) Kinder an, sondern wohl auch seine Künstlerkollegen und die Zunft der Ausstellungsmacher: „Kinder sind wir. Künstler. O je“, hatte ja auch Harald Szeemann zu Beginn der 1970er Jahren über sich und seine Klientel geseufzt.
Als Joseph Beuys diese Anrede wählte, war er längst zu einer Leitfigur des aktuellen Kunstbetriebs avanciert. Und diese Erfolgsgeschichte ging selbstverständlich nicht ohne Anlauf vonstatten, wozu die Kasseler Weltkunstausstellung die Bühne bereitete. Die Karriere der documenta und die des Joseph Beuys sind untrennbar miteinander verflochten. Die Stationen der Veranstaltungsreihe repräsentieren zugleich Stationen im Denken und Handeln des am heftigsten umstrittenen Repräsentanten der zeitgenössischen Kunst.
Die documenta – und ihre internationale Reputation – wirkten als Katalysator des Künstlers – und dessen internationaler Reputation. Wie die documenta-Ausstellungen sind daher auch die Beuys’schen Beiträge dazu aufeinander bezogen – besser gesagt: auseinander entwickelt. Und dieser subkutane soll hier im Überblick dargestellt werden.




documenta 3
Am Anfang war die Vitrine: ein abgewetztes Second-Hand-Möbel, aufgetrieben auf einem Dachboden der Stadt Kassel, darin eingelagert seltsam geformte Objekte:
3 Wachsplastiken, ausgelegt auf Holzbrettchen, mit beigegebenem Besteck, wie zum menschlichen Verzehr empfohlen: „Bienenkönigin I, II, III“, so der Titel der Exponate, entstanden 1952 und ausgestellt im Museum Fridericianum zur 3. documenta 1964.
Dies also der erste Auftritt eines Kunstprofessors mit Hut, zu einem Zeitpunkt, zu dem (wie die Akten zeigen) die Ausstellungsorganisatoren noch nicht einmal seinen Namen korrekt buchstabieren konnten. Für die, die ihn kannten, wurden aber bereits an dieser eher randständigen Anordnung Leitprinzipien seines individuellen Kunstbegriffs sichtbar: „Wärme“ und „Kälte“ als Kategorien der Kunst, die Beschäftigung mit der Idee des „Bienenstaates“, die Produktion von Wachs und Honig, die Biene als Metapher für menschliche Arbeit – Überlegungen, Symbole und Materialien also, die in der weiteren Werkentwicklung des Künstlers eine entscheidende Rolle spielen sollten.
Die Vitrinen-Präsentation wurde ergänzt durch eine flache zweiteilige Metallskulptur (1953) mit dem Titel „SÅFG-SÅUG“ („Sonnenaufgang-Sonnenuntergang“) sowie drei kleine Bleistiftskizzen in der Abteilung „Handzeichnungen“ der Alten Galerie (heute Neue Galerie).(1)
Arnold Bode hatte bekanntlich seine 3. documenta der Formel „Museum der 100 Tage“ unterstellt. Und er wollte mit seiner Kunst der Inszenierung exemplarisch vorführen, wie das ideale Museum der Gegenwart aussehen könnte. Die Gegenstände, die Joseph Beuys dazu beitrug, wurden nun allerdings untergebracht in der Abteilung „Aspekte 64“. Unter dieser Rubrik war versammelt, was zwar, wie Werner Haftmann befand, „das künstlerische Gesicht unserer Zeit“ mitprägte, aber seinem Dogma der folgerichtigen Entwicklung von einer das Sichtbare abbildenden zu einer das Unsichtbare sichtbar machenden Kunst nicht so ganz entsprach – d.h. beim Weg in die Abstraktion als verbindliche Weltsprache eher am Wegesrand lag – oder in der Lesart des Verlegers Lothar Schirmer: „Das war eigentlich der Salon des Refusés. Dort fand man die Künstler, die im Haupttrakt nicht untergebracht werden konnten, weil es im documenta-Rat keine Mehrheit gab, die man aber auch nicht wegschicken wollte.“(2)


Zu diesem eher querliegenden Kunstgut gehörte also auch der Beuys’sche Beitrag, so dass von einer überwältigenden Großinszenierung, wie sie Bode 1964 mit seiner Strategie „Bild und Skulptur im Raum“ beabsichtigte, bei diesen in der Ecke abgestellten Objekten keine Rede sein konnte. Symptomatisch auch, dass sie zudem noch von zwei unmittelbar darüber angebrachten, starkfarbigen Gemälden Valerio Adamis visuell übertönt wurden – eine unverständliche, geradezu skandalöse Maßnahme, die – bei aller Beuys-Würdigung und Bode-Verehrung – noch nie kritisiert worden ist.
Kein Wunder daher, dass der bescheidene Schaukasten und sein Inhalt im Windschatten auch der Presseberichterstattung bleiben. Die nämlich kommt über beiläufig-ironische Erwähnungen kaum hinaus: „Joseph Beuys, Düsseldorf, Lehrer an der dortigen Kunstakademie, stellt einige rohe Holzbretter aus, auf denen sich einige braune Kleckse befinden, die man als Bienenwachs identifizieren kann, weshalb das Ganze den Titel trägt: ‚Bienenkönigin‘“, befindet zum Beispiel ein Feuilleton der DDR,(3) die bewährte Strategie der Diffamierung durch Materialbenennung aufgreifend. Da möchte die lokale „Hessische Allgemeine“ nicht zurückstehen: Nicht ohne Häme beobachtet sie, dass Beuys der erste ist, der bereits am letzten Ausstellungstag seine Leihgabe wieder an sich nahm: „Er packte seine ‚Bienenkönigin‘ ins Auto und verschwand.“(4)
Noch kann also offensichtlich niemand ahnen, dass aus dem Hersteller dieser Objekte der bedeutendste nicht nur deutsche Künstler des 20. Jahrhunderts werden sollte – und der bei der documenta am häufigsten, exakt sieben Mal, präsente.
documenta 4
Wurde 1964 sein documenta-Beitrag noch mit weitgehender Missachtung bedacht, ändert sich dies schlagartig 1968, als sich auch seine Ambitionen ändern – und zugleich die der documenta: Für seine vierte Ausstellung hat Bode nämlich (obwohl schon weitgehend entmachtet) eine spezielle Kunstgattung eingeführt: „Environments“ auch „Ambientes“ genannt: dreidimensionale, begehbare Rauminszenierungen im Galeriegebäude an der Schönen Aussicht, die das Publikum zum Bestandteil des Werkes machen und den endgültigen „Ausstieg aus dem Tafelbild“ propagieren.
Und was Beuys nun anbietet, ist passgenau auf diese innovative Strategie am Ende der 1960er-Jahre zugeschnitten. Es ist der Ausstieg aus der Vitrine in eine „Raumplastik“ (so die offizielle Bezeichnung der Szenerie), der eine völlig neue Kunstauffassung zu Grunde liegt. Das Publikum sieht sich geworfen in eine beklemmende Inszenierung: rätselhafte Apparaturen in einem Experimentiersaal mit kupferbeschlagenen Tischen und unerklärlichen Gerätschaften, Regale mit isolierenden Filzmatten, Kupferstäbe (teils mit Filz ummantelt), eine Holzkiste und andere Überbleibsel früherer Aktionen des Künstlers – eine Mischung aus Abstellkammer und Frankenstein’schem Laboratorium, für einen Moment vom Experimentator verlassen, aber noch erfüllt von unklarer Erwartung und gemischte Gefühle zwischen Unbehagen und Neugier weckend. Diese „Raumplastik“ ist ein unter Strom stehendes Ambiente, das hin und wieder batteriegespeicherte Energie abstrahlt und wie eine Sendestation wirken soll. Als albtraumhaft wird die Materialansammlung empfunden, Hilflosigkeit und Ausweglosigkeit werden ihr zugeschrieben und Kafka liegt als zeitgemäße Vergleichsgröße nahe. „Atmosphäre“ ist der Schlüsselbegriff der massenmedialen Rezeption: „Atmosphäre einer Leichenhalle“ gar, durchzogen vom „Desinfektionsgeruch der Ungewissheit: wird von solchen Stätten je wieder Kunst ausgehen können?“(5) fragt sich die Presse, als die latent bedrohlich-geheimnisvolle Stimmung diesen Raum erfüllte und die ihn für alle, die sich ihm aussetzten, so irritierend machte.

Den Beweis für die emotionale Wirksamkeit der Inszenierung liefern auch erboste Besucher: Die nämlich – so heißt es in einem Bericht der Zeitung „Christ und Welt“ – „demolieren in einem Raum, dessen suggestiv öde Atmosphäre von scheinbar willkürlich angeordneten Latten, Filzdecken und schweren Kupfertischen nur noch unterstrichen wurde, einzelne dieser Versatzstücke. Sie zeigen sich außerstande, ohne Gewaltanwendung die Konfrontation mit einer Atmosphäre zu ertragen, deren künstlerischer Sinn in der Tat ohne philosophische, soziologische, literarische Interpretation nicht einzusehen ist. Nur jene begreifen sofort, deren Sinnesorgane so überzüchtet sind, daß sie dem Gehirn auf direktem Weg einen ungewöhnlichen Eingriff mit außerordentlichen Mitteln in das herrschende Kunst- und Kulturbewusstsein zu signalisieren vermögen.“(6)
Zu denen, deren Sinnesorgane so überzüchtet nicht sind, dass sie spontan in das „visuelle Begreifen“ kämen, dass Bode stets erreichen wollte, gehören nun aber gerade diejenigen, die dem akademischen Künstlerausbilder besonders am Herzen liegen. Es verwundert nämlich nicht, dass der Inneneinrichter dieses Raumes 1968 – auf dem Höhepunkt des studentischen Protests – in Konflikt gerät mit den gleichfalls auf Gesellschaftsveränderung angelegten Forderungen der Studentenbewegung, für die er sich an der Kunstakademie Düsseldorf und der „Deutschen Studentenpartei“ starkgemacht hatte. Es versteht sich, dass diese hermetischen Gebilde mit den revolutionären Theorien und Praktiken des akademischen Widerstands nur schwer in Einklang zu bringen sind.
documenta 5
Umso deutlicher geschieht das dann aber bei der 5. documenta Harald Szeemanns. 1972 geht Beuys nämlich einen entscheidenden Schritt weiter, indem er das Herstellen und Vorzeigen eines materiellen Exponats verweigert. Stattdessen betreibt er im Erdgeschoss des Fridericianums einen theoretischen Übungsraum: Das „Büro der Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung“, im Jahr zuvor in Düsseldorf gegründet, wird nach Kassel transferiert. Dort diskutiert der Bürovorsteher Tag für Tag während der gesamten Ausstellungslaufzeit geduldig mit dem Publikum über Demokratie, Ökonomie, Sozialismus, Produktionsmittel und Machtverhältnisse – sowie die Veränderung von all diesem. Er stellt sich den Fragen und Anwürfen und versucht, Missverständnissen gegenüber seiner Position entgegenzuwirken. Sein sogenannter „erweiterter Kunstbegriff“ – gefasst (und allzu oft missverstanden) unter der Formel „Jeder Mensch ein Künstler“ – kommt in dieser Dauerdebatte zur Entfaltung. Ein radikal verändertes Verständnis des Plastischen konstituiert sich mit diesem offenen Diskussionsforum. In ihm wird die Freiheit des Menschen in Selbstbestimmung zum Leitmotiv erhoben: zum gesellschaftlichen wie künstlerischen Produktionsmittel. Diese Entmaterialisierung der Kunst und ihre Verlagerung in diskursive Verfahren sucht die Erweiterung auch des Wissenschaftsbegriffs in einem gleichermaßen erweiterten Kunstbegriff.
Hatte Beuys zuvor den Ausstieg aus dem Bild in den Raum praktiziert, ist es nun der Ausstieg aus dem Raum – zumindest dem traditionellen Ausstellungs-Raum: in eine Sphäre des Kommunikativen, in der das Gespräch als Kunst, die Diskussion als ästhetische Praxis und das Seminar als Kreativität betrieben wird. Beispielhaft wird hier die gemeinschaftliche Dauerauseinandersetzung als konstruktiver Zustand der Gesellschaft erprobt. Diese Kunst bildet nicht, sie redet: Redestehen als ästhetische Praxis, Denken als Tat.

Genau so hatte sich Harald Szeemann wohl die – leider unverwirklichte – Idealkonstruktion seiner documenta vorgestellt, als er Arnold Bodes „Museum der 100 Tage“ in ein „100-Tage-Ereignis“ umzuformen gedachte.
Stets im Raum präsent ist eine täglich erneuerte rote Rose im Messzylinder: „Ohne die Rose tun wir’s nicht, da können wir gar nicht mehr denken“, so das Motto. Und selbstverständlich ist auch diese florale Geste mehr als nur Dekoration: Sie verweist auf Goethe, auf Rudolph Steiner, auf die Rosenkreuzer und andere rosarische Symbolik. Sie repräsentiert – als energiegespeiste Pflanze – das Prinzip des organischen Wachstums (das wenige Jahre später und an anderen Stellen in Kassel monumentalere Formen annehmen wird), während das geeichte Messgefäß die Sphäre des Intellekts, des Rationalen, also des apollinischen Prinzips verkörpert.
Als didaktische Hilfsmittel dieses Universalunterrichts kommen die herkömmlichen zum Einsatz: Schultafeln, die mit ihren Kreidezeichen die Spuren der Debatten bewahren: Diskurs-Diagramme, die anschließend (wie könnte es anders sein) als eigenständige Kunstwerke in den kunstmarktlichen Verwertungskreislauf integriert werden.
Einmal allerdings geht die verbale Auseinandersetzung in eine handfestere über: als sich der Künstler – nie kleinlich, wenn es um öffentliche Wirksamkeit geht – von dem aufstrebenden Jungkünstler Abraham David Christian (zu diesem Zeitpunkt noch mein Kommilitone an der Hochschule für bildende Künste) zu einem „Boxkampf für direkte Demokratie“ verleiten lässt. Im benachbarten Raum, dem von Ben Vautier, steigt Beuys in den Ring, um sich für seine Ideale stark zu machen und jenseits von Theorie einmal kräftig hinzulangen. Zu einem K.O. ist es dabei nicht gekommen, wohl aber zu einem klaren Punktsieg: Erwartungsgemäß ruft Ringrichter Anatol Joseph Beuys nach drei Runden zum Gewinner aus. Die direkte Demokratie hat über ihren parlamentarischen Herausforderer triumphiert.
documenta 6
Wiederum eine documenta später, 1977, zu Manfred Schneckenburgers sog. „Medien-documenta“, lässt sich Joseph Beuys auf eine zweigleisige Argumentation ein: auf den Prozess, zugleich aber auch auf die Installation. Wie fünf Jahre zuvor unterhält er (diesmal in der Erdgeschoss-Halbrotunde) ein 100-Tage-Seminar. Als unmittelbare Fortsetzung des „Büros für direkte Demokratie“ von 1972 betreibt nun die „Freie Internationale Hochschule für Kreativität und interdisziplinäre Forschung“ (FIU) die Öffnung von Wissenschaft und Denken in die allgemein zugängliche Sphäre des Sozialen. In einem kollektiven Lehr- und Lernprozess werden aktuelle Themen aus dem weiten Feld von Ökologie, Ökonomie und Tagespolitik verhandelt. Erneut wird das diskursive Miteinander zum Modell für künstlerische Kreativitätsprozesse.

Parallel zu dieser Dauerkonferenz macht die „Honigpumpe am Arbeitsplatz“ von sich reden. Am tiefsten Punkt des Fridericianums, im Untergeschoss der Halbrotunde, vom Treppenhaus her einsehbar, rotiert eine mit Elektromotoren angetriebene Kupferwelle langsam durch einen Margarineberg: der Arbeitsplatz. Gleichzeitig durchzieht von dort ausgehend ein Schlauch- und Röhrensystem das Museum: die „Honigpumpe“. Verflüssigter Langnese-Honig wird bis unter das Dach des Ausstellungsgebäudes transportiert, um anschließend in Windungen den Diskursraum der FIU zu durchströmen. In diesem Kreislauf sind Menschen und Themen durch einen kreativen Prozess miteinander verbunden. Symbolisch vollzieht sich hier die Bildung jener „Sozialen Plastik“, die gemeinhin „die Gesellschaft“ genannt wird. Dieser Zirkulationsprozess ist im Sinne des Erfinders mit vielfältiger Bedeutung aufgeladen: Blutkreislauf und Geldkreislauf, Kapital und Wirtschaftswerte finden sich darin aufgehoben.


Und in diesem System ist auch die documenta als ein sozialer Organismus entworfen, in dem sich die unterschiedlichen Kunstpositionen harmonisch zu einer Gesamtaussage verbinden mögen. So versöhnt Kunst die Widersprüche in der Gesellschaft.
Unverzichtbar ist die Mitwirkung des Künstlers auch bei der Eröffnungsperformance: Zur Satellitenübertragung aus dem Mittelbau der Orangerie steuert er eine 5‑minütige freie Ansprache bei („Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kinder!“) – selbstverständlich zum Thema „Kunst als sozialer Organismus“ bzw. umgekehrt. Wie er da – neben Nam June Paik (dem Video-Destrukteur), Charlotte Moorman (der Cello-Virtuosin) und Douglas Davis (dem Telekommunikationsmagier) – seine Kunst-Welt-Anschauung dem (abwesenden) Publikum vorträgt, ist der „filzhütige Mythenbeschwörer“ (als welchen ihn der „Spiegel“ titulierte) bereits selbst zum Mythos geworden. Während aber seine Künstlerkollegen jeweils ihr zum Markenzeichen ausgebautes Equipment nach Kräften strapazieren, verzichtet Beuys auf technische Apparaturen und verlässt sich ganz auf die auratische Wirkung seiner physischen Präsenz und der des Wortes: Sprechen als Skulptur.


Und was bei der 5. documenta der Boxkampf war, ist zur 6. das Fußballspiel. Auf der Hessenkampfbahn hinter der Orangerie treten am 14. September an: „Dynamo d6“ (Mitarbeiter und Künstler) gegen „Stavo-Kickers“ (eine Stadtverordnetenauswahl). Diesmal hält sich Beuys aber aus dem Kampfgeschehen heraus: Als Torwart versucht er für seine Künstler-Elf das Schlimmste zu verhindern.
documenta 7
Kunst in Grund und Boden
Hielt sich Beuys 1977 noch weitgehend im Museumsinneren auf, hält es ihn 1982 nicht mehr dort. Zur documenta 7 des Rudi Fuchs praktiziert er den Austritt aus dem Museum – und verschafft dieser documenta, die mit ihrem erklärten Rückzug in die Schutzzone des Musentempels mit dem öffentlichen Stadtraum nur wenig anzufangen weiß, eben dort das ausgedehnteste Exponat der documenta-Geschichte: „7000 Eichen – Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung“, das lebendige Geschenk an die Stadt Kassel und die in ihr Lebenden, das mit seiner Dynamik bis heute die Stadtgesellschaft beschäftigt. Ausgerechnet diejenige documenta also, die es programmgemäß darauf anlegt, sich selbst und die Kunst „von den verschiedenen Zwängen und gesellschaftlichen Verdrehungen zu befreien, in die sie verstrickt ist“, bekommt es mit einem Werk zu tun, das sich zutiefst in gesellschaftliche Verhältnisse einwurzelt. Denn der gewachsene und weiter wachsende ästhetische Organismus greift – wie kein anderes Kunstwerk weltweit – auf unmittelbar verständliche Weise radikal und nachhaltig in die visuelle, ökologische und soziale Struktur des urbanen Lebensraums der documenta-Stadt ein.

Während seiner sich hinziehenden Entstehungsphase besitzt das Projekt zunächst einen skulpturalen Zustand – wenngleich einen von dynamischem Charakter. Unmittelbar vor dem Fridericianum wird das Steindepot eingerichtet. Die keilförmige Ablagerung von 7000 Basaltstelen, mit Orientierung auf den Haupteingang des Museums und die 1. Pflanzung, kann nur dadurch abgetragen werden, dass Stück für Stück im Stadtgebiet ein Baum gesetzt und von seinem steinernen Begleiter schützend ankiert wird. Wie jedes Kunstobjekt, das im öffentlichen Raum dauerhafte Präsenz beansprucht, ist auch dieses der Beurteilung eines erweiterten Publikums ausgesetzt: eines, das seine urbane Umwelt mehrheitlich nach anderen als künstlerischen Kriterien bemisst. Die 7000 entstehen, wachsen und überdauern daher im Spannungsfeld von dankbarer Bewunderung und verständnisloser Ablehnung. Bei letzterer können die einen zwar das Bäume pflanzen als ökologisch sinnvolle Maßnahme (und notfalls als Kunst) akzeptieren, verweisen aber die zugehörigen Steine des Anstoßes in den Bereich des lebensgefährdenden Unsinns; andere können sich mit den Basalten arrangieren, sehen aber in den Bäumen Dreckschleudern und Parkraumvernichter.



Auf die komplexe Rolle des Hasen, der im Rahmen der symbolischen Menagerie des Künstlers sein Gesamtwerk durchläuft – zwischen Alter Ego und Unsterblichkeitszeichen – kann hier nicht weiter eingegangen werden. Für den Kasseler Kontext möge ein Satz von Veit Loers genügen: „Der Hase, im beuysschen Diagramm oft stellvertretend für die horizontalen Kräfte und in Verbindung mit Mineral, Pflanze und Mensch, opfert sich und hält mit seinem Blut das Kreislaufsystem in Gang, das in seinem Tod-Auferstehungs-Zyklus auch den neuen Menschen meint.“
Immerhin erbringt der spektakuläre Open-Air-Auftritt 777.000 DM zugunsten der Pflanzung. Während der documenta 7 in einer Art improvisiertem Wandtresor – zusammen mit den zuvor sorgsam ausgebrochenen Juwelen und einer sog. Sonnenkugel als Nebenprodukt – im Fridericianum präsentiert, ist das Werk heute in der Staatsgalerie Stuttgart zu besichtigen.

Joseph Beuys fügt mit dieser Demonstration den Zumutungen seines Kunstbegriffs eine weitere hinzu: War es für breite Kreise der Kasseler Öffentlichkeit anstrengend genug, Bäume, Basalt und das Pflanzen von beidem mit Kunst in Verbindung zu bringen, glaubt es ihm nun auch noch Kunstvernichtung vorwerfen zu müssen.
„Ich werde 7000 Bäume pflanzen“: Dieses verwegene Versprechen des Künstlers an die documenta und die documenta-Stadt war nun freilich leichter gesagt als getan. Es zeigte sich rasch, dass ein Künstler nun eben doch kein Gärtner und ein Spezialist für ästhetische Belange kein Universalgelehrter ist. So hat Beuys mancherlei unterschätzt: unter anderem den Umstand, dass unterhalb der oberirdisch sichtbaren Stadt eine unsichtbare existiert, deren subterrane Versorgungsstrukturen es unmöglich machen, an jedem Punkt der Stadt, an dem es angebracht zu sein scheint, ein Loch zu graben und einen Baum zu implantieren.

Die Folge: eine komplizierte Standortfindung im Zusammenspiel zwischen dem Wünschenswerten, den topogra schen Bedingungen und den behördlichen Vorgaben. Nur Fachleuten bewusst war wohl auch die Tatsache, dass es sich bei der Eiche um ein Gewächs handelt, das eine besondere Bodenbeschaffenheit verlangt, die nicht überall garantiert werden kann. Die Folge: zahlreiche andere Baumarten müssen als Ersatz zum Einsatz kommen. Durchaus vorhersehbar war hingegen, dass eine Stadt selbst ein lebendiger Organismus ist, der nicht an 7000 Punkten dauerhaft in seiner Entwicklung festgeschraubt werden kann. Die Folge: eine Flexibilität im Umgang mit dem oralen Erbe, mit der auf leidige so genannte „Sachzwänge“ der kommunalen Entwicklung kreativ reagiert werden muss. Allen Widerständen zum Trotz verwurzelt sich seit 1982 ein Kunstwerk im Kasseler Boden, das sich auch dadurch von der Mehrzahl der anderen unterscheidet, dass es permanenter Zuwendung bedarf. Sein Zustandekommen wie auch sein weiteres Überleben ist nicht nur angewiesen auf die dauerhafte Sympathie der Beschenkten, sondern auch einer Instanz, gegen die es sich bereits in seinem Titel wendet: der Stadtverwaltung. Das betreute Wachsen vollzieht sich über fünf Jahre hinweg technisch und finanziell mit Hilfe eines „Koordinationsbüros“ im kollektiven Kraftakt einer konzertierten Aktion aus Privatinitiativen und öffentlichem Engagement. Inzwischen unter Denkmalschutz stehend, ist es heute in der Obhut der „Stiftung 7000 Eichen“.

Den Abschluss des Großprojekts kann sein Initiator nicht mehr erleben, so wenig wie die Erfüllung seiner großen Utopie des Aufgehens der Gesellschaft in Kunst – und umgekehrt. Doch ist für Nachwuchs gesorgt: Nach seinem Tod 1986 pflanzt 1987 sein Sohn Wenzel die letzte Eiche neben die 1. vor das Fridericianum der 8. documenta.
documenta 8
Wer nun glaubte, dass damit der Ausstellungsreihe ihr jahrzehntelanges Flaggschiff abhandengekommen sei, irrte sich: Zur documenta 8 ist nämlich Beuys erneut und unübersehbar präsent. Manfred Schneckenburgers Ausstellung, die 1987 „neue historische und soziale Dimensionen“ in der Kunst entdeckt, die Krieg, Gewalt und kollektive wie individuelle Bedrohung zum Thema der Zeit erhebt und unter dem Schlagwort des „Utopieverlustes“ antritt, zeigt posthum ein Werk mit Endzeit-Charakter: „Blitzschlag mit Lichtschein auf Hirsch“, so der Titel der Großinstallation im Zentralraum des Fridericianums (dem einzigen Raum im Haus, der nach dem prekären Umbau noch die frühere Doppelgeschossigkeit aufweist). Die Inszenierung formuliert das erstaunlich pessimistische Vermächtnis jenes Künstlers, der doch zeitlebens mit revoltionärem Hoffnungspotenzial agiert und agitiert hat. Der „Blitzschlag“, ein gewaltiger Bronzekeil, kommt von oben über eine Landschaft, die besiedelt ist von gleichfalls im Bronze- und Aluminiumguss gestockten Lebewesen: Hirsch und Ziege. Am Boden verkrümmt einige „Urtiere“ (wie Beuys sie nennt): versehen mit rudimentären Werkzeug-Fortsätzen: aber kein Werkzeugkasten für eine technisch orientierte Zukunft, eher für die Demontage jeglicher Perspektive. Die Evolution scheint abgerissen, ein Neustart ausgeschlossen: So schnell wird sich hier nichts mehr zu einer neuen Krone der Schöpfung aufschwingen…

Der Bronzekeil wurde gewonnen als Abguss eines Segments jenes Berges aus Lehm – dem Stoff, aus dem das Leben wie die Kunst ist –, den Beuys zur Ausstellung „Zeitgeist“ im Berliner Martin-Gropius-Bau 1982 aufschütten ließ.
In vordergründiger Sicht ist dieser Lichtblitz, der seine Energie über eine schattenlose Welt ausschüttet, jener atomare Blitz, dessen permanente Möglichkeit (dem Zeitgeist der späten 1980er Jahre angemessen) sich bei der documenta 8 vielfältig thematisiert findet.
Doch über die konkrete Tagesaktualität hinaus artikuliert sich hier eine Endzeitvision von beängstigender Ausweglosigkeit, in der die Hoffnung auf die verändernde Wirkung künstlerischen Handels einer fundamentalen Skepsis Platz gemacht hat: (Welt-)Geschichte am Ende ihrer Möglichkeiten, eine zeitgemäße Variation der gescheiterten Hoffnung – doch ohne deutsch/romantische Grundierung.
Doch damit nicht genug: Zu diesem Zeitpunkt sind Beuys und sein Mythos längst selbst zum Gegenstand von Kunst geworden: In der Video-Installation „Beuys-Voice“ liefert Nam June Paik, der bis dato alles (wirklich alles) angestellt hat, was man mit dem Medium Fernsehen anstellen kann, mit 50 Monitoren in Bild und Ton eine monumentale Hommage an den jüngst Verstorbenen: ein pyramidaler Kenotaph aus akustischer und visueller Präsenz – ausgerechnet in jenem technischen Medium, dem Beuys stets misstrauisch gegenüberstand. Wie ein Echo aus früheren Tagen, als die Welt noch veränderbar schien, durchzieht nun die Hallen die Stimme – und der Geist – desjenigen, der bis vor kurzem hier umgegangen ist.

documenta 9
Am Anfang war die Vitrine – und am Ende steht das Regal. Im Zwehrenturm am Museum Fridericianum richtet Jan Hoet 1992 bei seiner documenta 9 in drei übereinander liegenden Räumen das „Kollektive Gedächtnis“ ein. In einer Walhalla mit den vom künstlerischen Leiter favorisierten Kulturhelden sollen dort die Auswahl- und Qualitätskriterien der Ausstellung verdeutlicht werden. Exemplarische Werke von 8 Künstlern der letzten 200 Jahre (u.a. Jacques Louis David, Paul Gauguin, Alberto Giacometti) werden aufgeboten, um das von der Ausstellung erzeugte Bild der Gegenwart nahtlos aus der Vergangenheit abzuleiten. Diese Heroenauswahl ist eine Variante jener Idee des „historischen Vorspanns“, mit der die frühen documenta-Veranstalter ihre aktuelle Werkauswahl nach rückwärts abzusichern suchten.
Und diese Rolle der kunsthistorischen Legitimation ist nun auch Joseph Beuys zugewiesen worden: auch er eingegangen in das gemeinschaftliche Gedächtnis einer kulturell interessierten Menschheit. Er ist dort präsent mit der Installation „Wirtschaftswerte“: einem schlichten Regal, karg bestückt mit Lebensmitteln aus der DDR, entstanden 1980, eine Leihgabe aus Jan Hoets Museum für Zeitgenössische Kunst in Gent. Auf‑, aus- und abgestellt sind Grundnahrungsmittel aus einem HO-Laden in Ost-Berlin, deren Schmucklosigkeit gemeinhin gleichgesetzt wird mit der Mangelwirtschaft im real existierenden Sozialismus. „Wirtschaftswerte“ formuliert die Diskrepanz zwischen der visuellen Kreativität der kapitalistischen Überfluss-Produktion mit der Scheinhaftigkeit ihrer Warenästhetik und dem sozialistischen Wirtschaftssystems mit seiner Reduktion auf die Grundbedürfnisse des täglichen Lebens. Für die documenta 9 wird also das Regal zum zentralen Symbol für Joseph Beuys: jenes Instrument der Ordnungsstiftung, der Systematisierung, der Differenzierung, aber auch der Ablage von nicht mehr Benötigtem.
Bei seinem Wiedereintritt in den musealen Schutzraum wird nun aber dem Star der Weltkunstausstellungen dort so wenig Aufmerksamkeit zuteil wie bei seinem 1. Auftritt 3 Jahrzehnte zuvor. Es existiert nicht einmal eine geeignete Abbildung der Kasseler Installation.

Wenn es noch eines weiteren Beweises für die musealisierte Stilllegung des früheren Bewegers bedarf, findet er sich in Guillaume Bijls Beitrag „History of documenta“. Denn inzwischen sind nicht nur seine Werke, sondern ist der Künstler selbst als Exponat in die Vitrine eingegangen. In der Inszenierung des belgischen documenta-Teilnehmers sehen wir Joseph Beuys (der, wie Jan Hoet sagt, „als Figur ein Prinzip geworden ist“), herbeizitiert als Ausstellungsstück im Außenschaufenster des Modehauses am Friedrichsplatz. Neben Gründer-Ehepaar Bode und dem jüngsten Spross Jan Hoet erstarrt im Wachsfigurenkabinett einer sakrosankten documenta-Geschichte: eine statische Schaufensterpuppe, zum Exponat geronnener, verstummter Zeuge seiner einstigen Bedeutung, als Schauobjekt im Käfig hinter Schneewittchen-Glas dem antiquarischen Interesse ausgeliefert. Weit und breit kein (Kron-)Prinz in Sicht, der ihn befreien/beerben könnte. Der einstige Motor des documenta-Geschehens ist (lange bevor er in Berlin dauerhaft bei Madame Tussauds einfährt) der Historisierung anheimgefallen, ohne dass ihm noch eine aktive Wirkung auf die Gegenwart zuzutrauen wäre. Das Wachs, mit dem er 1964 erstmals die documenta-Bühne betrat, wendet sich schließlich gegen ihn selbst.

Diesmal ist der Boxkampf also anders ausgegangen: Gewonnen hat beim Kampf um die Kunst nicht der Künstler-Veteran, sondern der Auch-Boxer Jan Hoet.
So hat die documenta also ihren Heros nicht nur jahrzehntelang protegiert, sondern am Ende zugleich unschädlich gemacht. Da ist denn der wirkungsreichste deutsche Künstler des 20. Jahrhunderts geradewegs vom Museum aufgebrochen, um draußen die Gesellschaft zu verändern, nur damit aus heutiger Sicht festgestellt werden muss, dass er lediglich um das documenta-Gebäude herumgegangen ist. Durch die Hintertür wurde er wieder eingeschleust, historisch vereinnahmt, und die klassischen Kunstkriterien haben sich seiner wieder bemächtigt. Die drei Jahrzehnte dauernde Exkursion aus dem Musentempel endet mit der Wiedereingliederung in dessen Ordnungsstrukturen – währenddessen aber draußen das Baum-Kunstwerk weiter wuchert…
© Fotos: documenta-Archiv